Wärmepumpe Kosten So heizt Du klimafreundlich und sparst Hunderte Euro

Finanztip-Expertin für Energetische Sanierung


Das Wichtigste in Kürze
Eine Wärmepumpe ist ein Heizsystem, das ohne Verbrennung von Öl, Gas oder Kohle auskommt. Stattdessen nutzt Du natürliche Wärmequellen wie Luft, Erde oder Grundwasser für Deine Heizung.
Wärmepumpenheizungen funktionieren nicht nur in Neubauten. Auch für bestehende Wohnhäuser können sie eine gute Lösung sein.
Eine Wärmepumpe ist teurer als andere Heizungen, aber der Staat fördert sie mit einem Zuschuss. Und Dein Bundesland oder Deine Stadt legt vielleicht nochmal etwas obendrauf.
So gehst Du vor
Ziehe für die Planung einen Energieeffizienz-Experten hinzu und suche Dir ein auf Wärmepumpen spezialisiertes Fachunternehmen.
Prüfe rechtzeitig die Fördermöglichkeiten. In der Regel musst Du Fördermittel beantragen, bevor Du die neue Heizung einbaust. Lass ein Jahr nach dem Einbau Deiner Wärmepumpenheizung durch das Fachunternehmen noch einmal alle Einstellungen überprüfen.
Wenn Du Dein Haus auch über den Heizungswechsel hinaus noch energieeffizienter gestalten möchtest, dann informiere Dich mit dem neuen Finanztip-Buch Energetisch Sanieren: Einfach erklärt über Deine Möglichkeiten.
Für Wärmepumpen kannst Du spezielle, günstige Stromtarife abschließen. Diese solltest Du am besten online vergleichen. Wir empfehlen dazu Check24. Auch Mut-zum-Wechseln, Stromauskunft, Verivox oder Wechseljetzt.de kannst Du nutzen.
Du hast einen Wärmepumpenstromtarif? Dann kannst Du Dir einen Teil Deiner Stromkosten zurückholen: die KWKG-Umlage und die Offshore-Netzumlage fallen für Dich weg. Nutze unser Musterschreiben, um das bei Deinem Stromanbieter anzumelden.
Inhalt
Wärmepumpen werden in Deutschland immer beliebter. Sie heizen ohne Erdgas, Öl oder Kohle und leisten damit einen wichtigen Beitrag für die CO2-Bilanz. Mit einer Wärmepumpenheizung kannst Du Dich außerdem von schwankenden Preisen für fossile Brennstoffe unabhängig machen. Sie ist allerdings teurer als manch anderes Heizsystem, braucht für den Betrieb Strom und funktioniert ganz ohne Vorarbeit nicht in jedem Wohnhaus.
Wärmepumpen sind eine umweltfreundliche Möglichkeit, ein Haus zu beheizen. Aber erst in den letzten Jahren sind sie bekannter und auch immer beliebter geworden. Bis 2020 hat der Verkauf von Wärmepumpen jedes Jahr nur langsam zugenommen, seitdem steigt der Absatz aber rasant an: Wurden 2019 noch 86.000 Wärmepumpen verkauft, waren es 2022 schon 236.000 Stück. Es ist das Ziel der Bundesregierung, dass ab 2024 sogar jährlich mindestens 500.000 Wärmepumpen eingebaut werden sollen.
Das Prinzip der Wärmepumpe ist viel älter, als Du vielleicht denkst. Schon vor knapp 200 Jahren hat der französische Physiker Nicolas Carnot Grundlagen zur Funktionsweise der Wärmepumpe veröffentlicht. Nur etwas mehr als 100 Jahre später wurde im Rathaus der Stadt Zürich bereits die erste Wärmepumpe installiert.
Das Prinzip der Wärmepumpe ist einfach: Das Gerät nutzt statt der Verbrennung von Gas, Öl oder Kohle eine Wärmequelle aus der Umwelt, um damit eine bestimmte Fläche zu beheizen – zum Beispiel Dein Haus. Dieser Prozess erfordert natürlich noch ein paar Schritte mehr.
Im Rahmen der Energiewende möchte die Bundesregierung den Einbau von umweltfreundlicher Heizungstechnik, die nicht von fossilen Brennstoffen abhängig ist, stärker vorantreiben und fördern. Denn bei einer Heizung mit Wärmepumpe brauchst Du kein Gas, Öl oder Holz mehr, um sie zu betreiben. Nur noch etwas Strom und eine gute Wärmequelle sind notwendig, um Dein Zuhause zu beheizen. Und das Beste ist: Mit einer Wärmepumpe kannst Du bei entsprechender Installation Dein Haus im Sommer auch kühlen. Wie das funktioniert und was gute Wärmequellen für eine Wärmepumpe sind, erfährst Du im nächsten Kapitel.
Stell Dir eine Wärmepumpe wie einen Kühlschrank vor, dessen Funktionsweise ins Gegenteil umgekehrt wurde: Während der Kühlschrank seinem Inneren Wärme entzieht und nach außen abgibt, um das Innere kühl zu halten, macht es die Wärmepumpe genau andersherum.
Sie entzieht einer Quelle aus der Umgebung Wärme, zum Beispiel der Luft oder der Erde, um Dein Haus zu heizen. Aber wie funktioniert das im Detail?
Ähnlich wie ein Öl- oder Gasheizkessel kann die Wärmepumpe bei Dir im Keller stehen und Dein Haus mit Wärme versorgen. Dafür braucht sie aber im Gegensatz zu den anderen beiden Heiztechniken keinen fossilen Brennstoff, sondern nur eine Wärmequelle.
Das können zum Beispiel die Umgebungsluft außerhalb Deines Hauses, die Wärme der Erde oder des Grundwassers sein. Die Temperatur der Wärmequelle wird, außer bei Wärmepumpen, die die Umgebungsluft nutzen, an eine Flüssigkeit, die so genannte Sole, weitergegeben. Diese Sole besteht in der Regel aus Wasser und Frostschutzmittel. Sie nimmt die Temperatur der Wärmequelle an und wird in die Wärmepumpe in Deinem Haus geleitet. Dort gibt die Sole ihre Temperatur an ein Kältemittel ab, welches durch die Erwärmung verdampft. Das ist ein sogenannter Wärmetauschprozess.
Durch ihre spezielle Wärmeleitfähigkeit und chemische Zusammensetzung können Kältemittel auch bei sehr geringen Temperaturen und auch bei Minusgraden verdampfen. Der Dampf wird dann in einen Kompressor weitergeleitet, in dem er immer weiter verdichtet wird, wobei er sich mehr und mehr erhitzt. Wenn der Dampf die gewünschte Vorlauftemperatur, also die Temperatur, die in Deinen Heizkreislauf eingespeist wird, erreicht hat, wird er zum sogenannten Verflüssiger weitergeleitet. Dort gibt das Gas seine Wärme an das Wasser ab, das zum Beispiel durch Deine Heizungen fließt. Dabei kühlt sich das gasförmige Kältemittel ab und wird wieder flüssig. Im letzten Schritt wird in der sogenannten Drossel der Druck wieder vom Kältemittel genommen und es wird entspannt. Danach beginnt der Kreislauf des Kältemittels wieder von vorne.
Für die Prozesse des Verdichtens und Entspannens braucht die Wärmepumpe Strom. Auch wenn die Temperatur der Wärmequelle zeitweise nicht ausreicht, um die nötige Vorlauftemperatur für Deine Heizung zu erreichen, wird Strom benötigt. Denn dann kommt ein elektrischer Heizstab zum Einsatz, der die Temperatur erhöhen kann. Wenn Deine Wärmepumpenheizung gut und richtig auf Dein Haus abgestimmt und geplant wurde, wird der Heizstab aber nur sehr selten zum Einsatz kommen.
Das Gute dabei ist: Die Wärmepumpe benötigt nur wenig Strom, um im Verhältnis viel mehr Wärme zu erzeugen. So bekommst Du mit einer Kilowattstunde Strom zwischen drei und fünf Kilowattstunden Wärme. Genau dieses Verhältnis beschreibt die Jahresarbeitszahl (JAZ) Deiner Wärmepumpe. Eine JAZ von 4 bedeutet also, dass Du mit einer Kilowattstunde Strom vier Kilowattstunden Wärme erzeugst. Ein guter Heizungsbauer kann Dir anhand der Gegebenheiten Deines Hauses und der gewählten Wärmepumpe schon vorab ungefähr sagen, welche JAZ Deine geplante Wärmepumpe erreichen wird. Die Jahresarbeitszahl ist wichtig, um auch die Wirtschaftlichkeit Deiner Wärmepumpe zu beschreiben. Wenn sie unter 3 liegt, arbeitet Deine Wärmepumpe nicht effizient und kostet Dich im Betrieb zu viel Geld. Bei einer Jahresarbeitszahl, die unter 2,5 liegt, bekommst Du auch keine Förderung mehr für Deine Wärmepumpe.
Wenn Du zeitgleich noch eine Photovoltaikanlage betreibst, kannst Du sogar den erzeugten Solarstrom nutzen, um Deine Wärmepumpe zu betreiben. Wenn Du einen Stromtarif für Deine Wärmepumpe abschließen möchtest, kannst Du in unserem Ratgeber zu Wärmepumpen-Stromtarifen nachlesen, wie Du einen guten Tarif findest. Wenn Du einen Ökotarif wählst, heizt Du komplett CO2-frei.
Die Luftwärmepumpe gibt es in zwei Ausführungen: Die Luft-Luft-Wärmepumpe und die Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Die Luft-Luft-Wärmepumpe kommt dabei in der Regel nur in Passiv- oder Niedrigenergiehäusern zum Einsatz, in denen sie die Abluft aus der Lüftungsanlage, mit der sie verbunden ist, als Wärmequelle nutzt. In Passivhäusern sind Lüftungsanlagen häufig nötig, um einen gleichmäßigen Luftaustausch zu gewährleisten. So werden zum Beispiel Essensgerüche oder Feuchtigkeit aus Deinem Haus wieder nach außen abgegeben und frische Luft reingelassen. Da ein Passivhaus sehr gut gedämmt ist, ist so eine Lüftung notwendig. Die Wärmepumpe nutzt dann die Wärme der Luft, die Deine Abluftanlage nach außen abgibt, um Dein Haus zu heizen. Du kannst Luft-Luft-Wärmepumpen allerdings auch ohne Lüftungsanlage nutzen. Wie bei einer Klimaanlage hängt dabei je ein Gerät außen und innen in Deinen Räumen. Dabei wird die Außenluft als Wärmequelle genutzt und über einen Ventilator angesaugt und die erzeugte Wärme wird über das Innengerät in den Raum abgegeben. Die Luft-Luft-Wärmepumpe ist dabei sehr günstig und einfach zu installieren, da es kein wassergeführtes Heizungssystem benötigt. In Bestandsgebäuden eignet sie sich gut als Unterstützung zur bestehenden Heizungsanlage.
Für ein Bestandsgebäude ist auch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe gut geeignet. Bei dieser Art der Wärmepumpe wird der Umgebungsluft außerhalb Deines Hauses die Wärme entzogen. Dabei saugt ein Ventilator die Luft an und ihre Wärme wird über den Wärmetauschprozess an das in der Wärmepumpe zirkulierende Kältemittel abgegeben, wodurch im weiteren Prozess – wie im zweiten Kapitel beschrieben – Heizenergie entsteht. Im Winter muss hierfür deutlich mehr Luft angesaugt werden, da sie weniger Energie (also Wärme) enthält. Dadurch kann das Außengerät, das die Ventilatoren enthält, im Winter deutlich lauter im Betrieb werden. Diese Geräusche fallen unter den Schallschutz und müssen beim Aufstellen des Außengeräts bedacht werden, damit Deine Nachbarn und auch Du selbst nicht gestört werden. Moderne Wärmepumpen werden aber immer leiser im Betrieb.
Erdwärmepumpen gibt es ebenfalls in unterschiedlichen Ausführungen. In allen Varianten zirkuliert eine Sole, also eine frostsichere Flüssigkeit, durch einen Kreislauf aus Kunststoffrohren durch die Erde und nimmt die Erdwärme auf.
Mit einer Erdwärmesonde wird die notwendige Wärme tief aus der Erde geholt. Ab einer Tiefe von zehn Metern ist die Temperatur im Erdinneren nahezu konstant, wodurch die Wärmepumpe mit einer Erdwärmesonde eine sehr hohe Effizienz aufweist, da sie keine Temperaturschwankungen ausgleichen muss wie etwa die Luft-Wasser-Wärmepumpe. Für eine oder mehrere Bohrungen ins Erdreich, etwa 50 bis 100 Meter tief, brauchst Du allerdings eine Genehmigung. Zudem kann eine solche Bohrung sehr teuer sein.
Wärmekollektoren werden nur etwa 1,5 Meter tief über eine größere Fläche im Boden verlegt. Hier wird beispielsweise die Energie der Sonne, die das Erdreich erwärmt hat, genutzt. Du brauchst keine speziellen Genehmigungen, dafür benötigst Du für Wärmekollektoren eine größere Fläche in Deinem Garten, die dann nicht mehr bebaut oder versiegelt werden darf. Die Fläche muss in der Regel mindestens 1,5-mal so groß sein wie die Heizfläche Deines Hauses. Wenn Du also keine ausreichend große Fläche in Deinem Garten hast, kommen Wärmekollektoren nicht infrage.
Eine dritte Möglichkeit sind Erdwärmekörbe, die nicht ganz so tief liegen wie eine Erdwärmesonde. Sie werden ein bis vier Meter tief in die Erde gesetzt und benötigen keine Genehmigung oder besonders viel Raum. Auch eine teure Bohrung fällt weg.
Eine weitere mögliche Wärmequelle für eine Erdwärmepumpe ist ein Eisspeicher. Dabei handelt es sich um eine große Betonzisterne, die in Deinem Garten vergraben wird. Darin werden Leitungen verlegt, durch die die Sole fließt. Sie nimmt die Wärme des Wassers im Eisspeicher auf, bis dieses so weit abgekühlt ist, dass es gefriert. Und beim Gefrierprozess entsteht dann durch den Phasenwechsel von flüssig zu fest noch einmal besonders viel Energie, die Deine Wärmepumpe gut nutzen kann. Damit das Wasser wieder flüssig wird, muss dem Eisspeicher Wärme zugeführt werden. Das passiert am besten über eine Solarthermie-Anlage, die die Wärme der Sonne nutzt, um das Wasser im Eisspeicher wieder aufzutauen. In der Zeit, in der diese Wärme im Eisspeicher nicht gebraucht wird, kann die Solarthermieanlage auch das Trinkwasser in Deinem Haus erwärmen.
Als letztes gibt es noch die Grundwasserwärmepumpe, auch Wasser-Wasser-Wärmepumpe genannt. Diese Art der Wärmepumpe nutzt das Grundwasser als Wärmequelle. Das Grundwasser hat ganzjährig eine sehr konstante Temperatur von acht bis zwölf Grad und kann so als Wärmequelle besonders effizient für Deine Wärmepumpe arbeiten. Sie kann eine Jahresarbeitszahl von 5 erreichen, Du erzeugst also mit einer Kilowattstunde Strom ganze fünf Kilowattstunden Wärme. Ein Nachteil: Die Grundwasserwärmepumpe ist sehr teuer, denn Du musst auch hier sehr tief bohren lassen und eine Genehmigung für die Bohrung und das Anzapfen des Grundwassers einholen. In einigen Regionen ist die Nutzung von Grundwasser mit einer Wärmepumpe grundsätzlich untersagt, zum Beispiel in Wasserschutzgebieten. Außerdem kann es in seltenen Fällen passieren, dass in besonders heißen oder trockenen Sommern der Grundwasserspiegel sinkt und Deine Wärmepumpe auf dem Trockenen liegt. Da die Installation sehr aufwändig und teuer ist, lohnen sich Grundwasserwärmepumpen eher für sehr große Gebäude.
Es gibt also eine Vielzahl an Möglichkeiten, um eine Wärmepumpe zu nutzen. Die meisten Wohnhäuser können effizient mit dieser Technik beheizt werden. Welche Anforderungen an Dein Haus gestellt werden, liest Du im nächsten Kapitel.
Neue Heizung, Dämmung oder Fenster: In unserem Ratgeber-Buch findest Du alle Grundlagen zur energetischen Sanierung. Mit hilfreichen Checklisten und den besten Tipps der Experten.
Ein Vorurteil hält sich hartnäckig: Eine Wärmepumpe könne nur funktionieren, wenn ein Haus komplett energetisch saniert ist und darüber hinaus eine Fußbodenheizung hat. Dieses Vorurteil ist aber nicht richtig.
Wenn Du mit dem Gedanken spielst, eine Wärmepumpe zu installieren, wirst Du dafür sicherlich einen Heizungsbauer beauftragen. Am besten einen, der auch auf Wärmepumpen spezialisiert ist. Dieser wird sich dann Dein Haus sehr genau anschauen. Dabei betrachtet er vor allem Deine Heizkörper sowie den Energiebedarf und den energetischen Zustand Deines Hauses. Zugegeben, wenn der Sanierungszustand Deines Hauses sehr schlecht ist, dort also zum Beispiel seit 40 Jahren nichts gemacht worden ist, wie etwa mal Erneuerung oder Sanierung der Fenster, des Dachs oder der Fassade, dann könnte es mit einer Wärmepumpe schwierig werden.
Besonders gut ist es, wenn Deine Heizkörper eine große Fläche haben, denn dann können sie mehr warme Luft in den Raum abgeben. Deswegen sind auch Fußboden- oder Deckenheizungen besonders gut geeignet. Die Wärmepumpe muss dann nämlich eine geringere Vorlauftemperatur für Deinen Heizkreislauf erreichen, weil Dein Haus durch größere Heizkörper effizienter geheizt werden kann. Es geht aber auch mit den traditionellen Heizkörpern, denn die meisten sind für die modernen Wärmepumpen inzwischen groß genug. Zudem wurden früher auch häufig überdimensionierte Heizkörper verbaut – das kommt der Wärmepumpe jetzt zugute. Dein Heizungsbauer weiß auch, wie Du die Wärmepumpe noch effizienter machen kannst: Du könntest zum Beispiel einzelne Heizkörper austauschen, das ist in der Regel nicht sehr teuer. Besonders geeignet sind hier Niedertemperaturheizkörper, da diese durch ihr Design mit einer deutlich niedrigeren Vorlauftemperatur Deine Räume noch besser und effizienter aufheizen als herkömmliche Rippenheizkörper. Wenn man möchte, kann man auch eine Fußbodenheizung nachrüsten, eventuell ist auch eine Deckenheizung möglich.
Einzelne energetische Maßnahmen sind ebenfalls denkbar, insbesondere, wenn Du sie ohnehin geplant hattest. Das Gute ist, dass Du auch für diese Maßnahmen eine Förderung erhältst und darüber hinaus Deine Energiekosten senken und gleichzeitig den Wert Deines Hauses steigern kannst. So kannst Du zum Beispiel Dein Dach oder Deine Fassade dämmen oder auch die Fenster austauschen.
Wie Du prüfen kannst, ob eine Wärmepumpe in Deinem Altbau schon effizient funktioniert, kannst Du in unserem Ratgeber zur Wärmepumpe im Altbau nachlesen.
Wie viel Du genau für eine Wärmepumpe bezahlen musst, lässt sich leider nicht exakt beziffern. Denn die Kosten setzen sich aus unterschiedlichen Größen zusammen:
Der komplette Preis bildet sich aus diesen drei Faktoren und kann sich daher je nach Haus und Region stark unterscheiden.
Wie viel eine neue Wärmepumpe kostet, ist abhängig vom Hersteller, den Du auswählst und von der notwendigen Heizleistung. Je höher die Heizleistung sein muss, desto teurer ist in der Regel die Wärmepumpe. Um die Heizleistung zu senken, kannst Du energetische Sanierungsmaßnahmen wie die Dämmung der obersten Geschossdecke, der Kellerdecke oder der Fassade ins Auge fassen. Wenn Dein Heizungswechsel nicht dringend ist, kann es sinnvoll sein, Dich erstmal mit Deinem Haus zu beschäftigen. Wo Energiesparpotenzial besteht, kann Dir ein Energieberater aufzeigen.
Nur in wenigen Fällen kommt es dazu, dass Du die Wärmepumpe selbst anschaffst. Denn in der Regel ist diese Teil eines Liefer- und Leistungsvertrages mit einem Heizungsinstallateur. Dieser kauft die Wärmepumpe für Dich ein, schlägt aber noch eine gewisse Marge auf den Preis drauf, um auch selbst noch etwas daran zu verdienen. Dafür kannst Du aber bei einer Fachfirma mit Erfahrung im Wärmepumpeneinbau sicher sein, dass sie ein Gerät auswählt, das genau zu Deinem Haus passt.
Allein für die Anschaffung musst Du für alle Wärmepumpenarten mit Kosten zwischen 8.000 bis 16.000 Euro rechnen. Bei einer solch großen Spanne kann es sich deshalb lohnen, Angebote von unterschiedlichen Installateuren einzuholen, um Preise vergleichen zu können.
Die neue Wärmepumpe muss aber auch noch installiert werden. Bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe geht die Installation schneller und dauert in der Regel nur wenige Tage. Muss eine alte Heizungsanlage deinstalliert werden, kann es etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Für die Installation wird Dir Material und Zeit in Rechnung gestellt.
Gemäß Erhebungen des Baukosteninformationszentrums lag der durchschnittliche Stundensatz für einen Heizungsmonteur im zweiten Quartal 2023 bei 78 Euro pro Stunde. Häufig wird für die Installation aber eine Pauschale vereinbart, die mehrere Tausend Euro betragen kann. Das zusätzlich benötigte Material ist von den Gegebenheiten in Deinem Haus abhängig und besteht in der Regel aus Rohrleitungen, Ventilen, Dichtungen, Elektromaterial und vielen anderen Kleinteilen.
Bei Erd- und Grundwasserwärmepumpen ist die Installation aufwendiger und teurer, da die Wärmequelle erst noch erschlossen werden muss. Hierfür müssen entweder tiefe Bohrungen von 100 Metern oder mehr ins Erdreich vorgenommen werden oder es müssen Wärmekollektoren in Deinem Garten verlegt werden. Diese Arbeiten können auch wieder mehrere Tage in Anspruch nehmen. Für die Verlegung von Kollektoren musst Du mit Extrakosten von bis zu 8.000 Euro rechnen, während die Bohrung für eine Wärmesonde bis zu 13.000 Euro kosten kann.
Nicht zu unterschätzen sind auch die Kosten, die nichts mit Anschaffung und Installation zu tun haben. Dabei gilt: Je besser Dein Haus auf eine Wärmepumpe vorbereitet ist, desto weniger dieser Umfeldmaßnahmen und entsprechende Kosten fallen an. Zu diesen Arbeiten zählt alles, was für die Vorbereitung und Installation notwendig ist. Ein Beispiel ist die Optimierung Deines Heizverteilsystems, also der Heizkörper und Rohrleitungen. Womöglich muss Dein Rohrsystem für den Betrieb einer Wärmepumpe umgebaut werden. Auch der Austausch einzelner Heizkörper kann notwendig werden, damit die Wärmepumpe effizienter laufen kann. Dafür werden beispielsweise Niedertemperaturheizkörper verbaut, die die Wärme aufgrund ihres Aufbaus effizienter abgeben. Auch der hydraulische Abgleich nach der Installation einer neuen Wärmepumpenheizung ist notwendig und wichtig, um den korrekten Wasserdurchfluss aller Heizkörper einzustellen.
Soll die Wärmepumpe gleich Wärme auf Vorrat produzieren, kommt die Installation von Pufferspeichern hinzu. Darin wird die Wärme, die Deine Wärmepumpe herstellt, in Form von heißem Wasser gespeichert, das an Deine Heizkörper oder Deine Warmwasserversorgung bei Bedarf abgegeben werden kann.
Abhängig davon, wie viele Umfeldmaßnahmen notwendig sind, können dafür Kosten im drei- bis vierstelligen Bereich entstehen. Die gute Nachricht: Auch Umfeldmaßnahmen werden beim Heizungstausch mitgefördert.
Du siehst, dass die genauen Kosten von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängen und für jedes Haus ganz anders ausfallen können. Es ist daher nicht möglich, konkrete Preisangaben zu machen.
In der folgenden Übersicht haben wir Dir die möglichen Preisspannen für eine Luft- und eine Erdwärmepumpe aufgelistet:
| Wärmepumpe | Kosten |
|---|---|
| Luft-Wasser-Wärmepumpe | 15.000 – 40.000 Euro |
| Erdwärmepumpe | 30.000 – 50.000 Euro |
Beachte dabei, dass die Preise stark von Angebot und Nachfrage getrieben werden und auch regional unterschiedlich ausfallen können. Du solltest Dir im Idealfall immer Vergleichsangebote einholen, um ein Gefühl für einen realistischen Preis zu bekommen.
Wenn Du Fördergelder bekommst, sinken die Kosten entsprechend. Es gibt sowohl staatliche als auch regionale Förderprogramme, die Du nutzen kannst. Alles zur Förderung liest Du im Abschnitt Welche Förderungen gibt es?
Wie alle Heizsysteme haben auch Wärmepumpen Vor- und Nachteile. Ein Nachteil: Die Wärmepumpe kann nicht in jedes Haus eingebaut werden. Gewisse Anforderung an den Sanierungszustand, den Energiebedarf und die Heizkörper sind notwendig. Zudem ist die Wärmepumpe auch oft deutlich teurer als herkömmliche Heizsysteme, die auf fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl oder Gas beruhen.
Während Du zum Beispiel bei einer neuen Gasheizung für Dein Einfamilienhaus mit Kosten für Anschaffung und Installation bis zu 15.000 Euro rechnen musst, kostet eine Luft-Wasser-Wärmepumpe bis zu 40.000 Euro. Für die Erschließung einer Wärmequelle fallen in diesem Fall keine Kosten an. Das sieht bei Erd- und Grundwasserwärmepumpen schon anders aus. Zu den Anschaffungskosten kommen da noch bis zu 13.000 Euro Erschließungskosten hinzu, da Du in die Erde bohren lassen musst. Wenn Du von einer Gas- oder Ölheizung auf eine Wärmepumpe umrüstest, kommen noch Arbeiten im Umfeld Deines Hauses hinzu, die die Installation zusätzlich teurer machen.
Die Preise für die Installation einer Wärmepumpe können dabei regional und abhängig von der Nachfrage stark schwanken und deutlich höher liegen. Daher solltest Du immer mehrere Angebote für Dein Projekt einholen, um besser vergleichen zu können.
Ein weiterer Nachteil ist, dass eine Wärmepumpenheizung eine sehr sorgfältige Planung erfordert, damit sie später effizient laufen kann. Da sich bisher noch nicht alle Heizungsinstallateure ausreichend mit der Technologie auskennen, kann es zu falsch geplanten und installierten Wärmepumpen kommen. Und das kann im Betrieb teuer werden. Achte daher darauf, dass Dein ausgewählter Installationsbetrieb bereits Erfahrung mit Wärmepumpen vorweisen kann.
Der höhere Preis wird deutlich von den Fördermöglichkeiten gedämpft. Neue Gas- und Ölheizungen werden inzwischen nicht mehr gefördert, sodass Du hier den vollen Preis bezahlen müsstest. Zudem hast Du mit einer Wärmepumpe keine großen Preisschwankungen für Gas oder Öl mehr zu befürchten und auch die Wartungskosten sind deutlich geringer. Da Deine Wärmepumpe nichts mehr verbrennt, sind ein Schornstein und entsprechend auch der jährliche Besuch des Schornsteinfegers für die Feuerstättenschau nicht mehr notwendig.
Wenn Du etwas für den Klimaschutz tun möchtest, ist der Umstieg auf ein Heizsystem, das mit erneuerbaren Energien betrieben wird, ohnehin besser. Für den Austausch Deiner alten Gas- oder Ölheizung bekommst Du noch einen zusätzlichen Bonus. Oft sind diese alten Kessel früher auch überdimensioniert worden, sind also eigentlich viel zu groß für Dein Wohnhaus. Das führt dazu, dass sie besonders im Frühjahr und Herbst häufig an- und ausgehen, um kurzzeitig Wärme zu produzieren. Da sie so groß sind, geht das sehr schnell und sie schalten dann wieder ab. Das macht sie nicht nur sehr ineffizient, sondern führt durch einen höheren Brennstoffbedarf auch zu einer deutlich größeren CO2-Belastung.
Wenn Du Dich für eine Wärmepumpe entscheidest, brauchst Du für ihren Betrieb nur noch Strom. Und wenn sie gut geplant und an Dein Haus angepasst wurde, sollte sie im Verhältnis nur sehr wenig Strom brauchen, um die nötige Wärme zu erzeugen. Wieviel Strom sie dafür benötigt, ist sehr abhängig von dem Wärmepumpentyp, den Du wählst und dem Energiebedarf Deines Hauses:
Wie groß ist Dein Haus?
Wie ist sein energetischer Zustand?
Welche Art von Heizkörpern wird genutzt?
Der Energiebedarf von unsanierten alten Häusern liegt in der Regel bei 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter und mehr. Ein gut gedämmtes Haus kann dagegen einen deutlich geringeren Bedarf von nur noch 60 Kilowattstunden pro Quadratmeter haben. Für ein 150 Quadratmeter großes Haus bedeutet das im unsanierten Zustand einen Energiebedarf von 37.500 Kilowattstunden und im sanierten Zustand von 9.000 Kilowattstunden.
Zwar ist Strom pro Kilowattstunde teurer als Gas oder Heizöl, allerdings nutzt die Wärmepumpe zur Wärmeerzeugung zum größten Teil Energie aus der Umwelt. Eine effiziente Wärmepumpe benötigt nur eine Kilowattstunde Strom für die Produktion von drei oder mehr Kilowattstunden Wärme. Mit einer Wärmepumpe kannst Du zudem Wärmepumpenstromtarife nutzen, welche in der Regel günstiger sind als normaler Haushaltsstrom.
Wenn wir die Energiekosten für unser Beispielhaus mit 150 Quadratmetern im sanierten und unsanierten Zustand berechnen, ergeben sich folgende Kosten:
| Hauszustand | Gaskosten | Stromkosten |
|---|---|---|
| unsaniert | 4.725 Euro | 3.500 Euro |
| saniert | 1.134 Euro | 840 Euro |
Quelle: Finanztip-Berechnung; Die Gas- und Stromkosten orientieren sich dabei an den Energiepreisbremsen von 12 Cent pro kWh für Gas und 28 Cent pro kWh für Wärmepumpenstrom. Stand: 14. Dezember 2023
Bei dieser Kostenberechnung gehen wir von einer effizienten Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl von 3 aus. Ist die Wärmepumpe nicht gut geplant und ineffizient, können die Stromkosten deutlich höher ausfallen. Entsprechend geringer können sie aber sein, wenn die Wärmepumpe mit einer besseren Jahresarbeitszahl läuft.
Auch Gasheizungen haben eine bestimmte Effizienz, die mithilfe des Wirkungsgrades beschrieben wird. Wir sind bei der Berechnung von einer modernen Gasbrennwertheizung mit einem Wirkungsgrad von 95 Prozent ausgegangen. Das bedeutet, dass aus 100 Kilowattstunden Gas 95 Kilowattstunden Wärme entstehen. Du musst also mehr Gas einkaufen, um den Wärmebedarf Deines Hauses zu decken. Ist Deine Gasheizung schon älter, fällt der Wirkungsgrad teilweise deutlich schlechter aus.
Hast Du eine Wärmepumpe, kannst Du auch noch zusätzlich Stromkosten sparen, wenn Du eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hast. Dann kannst Du deren erzeugten Strom auch für den Antrieb Deiner Wärmepumpe nutzen und musst weniger Strom hinzukaufen.
Für den Strombezug kannst Du einen speziellen Wärmepumpen-Stromtarif abschließen. Beachte dabei, dass Du einen gesonderten Zähler für Deine Wärmepumpe brauchst und dass sie steuerbar sein muss. Tarife für Wärmepumpenstrom sind in der Regel günstiger als der normale Haushaltsstrom. Wie bei allen Stromtarifen lohnt sich auch hier der Vergleich der unterschiedlichen Anbieter. Dafür nutzt Du am besten Vergleichsportale. Wir empfehlen Check24. Daneben kannst Du Angebote auch über Mut-zum-Wechseln, Stromauskunft, Verivox oder Wechseljetzt.de vergleichen – diese vier Portale empfehlen wir mit Abstrichen gleichermaßen und nennen sie stets in alphabetischer Reihenfolge. Diese Portale haben wir zuletzt ausführlich getestet. Den Test und alles weitere findest Du in unserem ausführlichen Ratgeber zu Stromtarifen für Wärmepumpen.
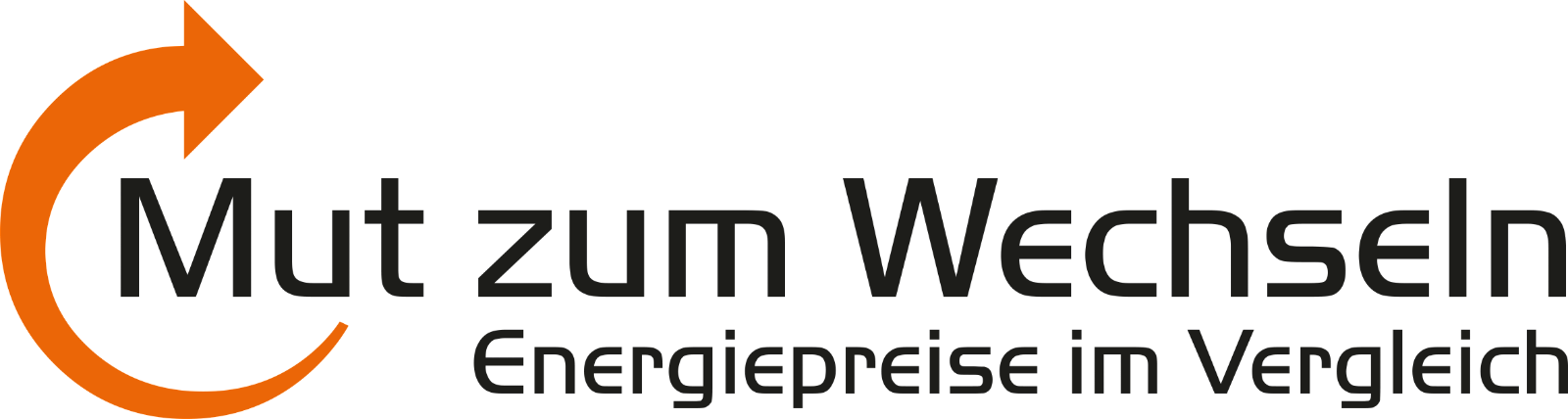


Wenn Du eine Wärmepumpe mit eigenem Stromzähler betreibst, kannst Du einen Teil Deiner Stromkosten zurückholen – nämlich den Anteil für die KWKG-Umlage und die Offshore-Netzumlage. Gemäß Paragraf 22 Absatz 1 des Energiefinanzierungsgesetzes (EnFG) verringert sich die Höhe dieser Umlagen für Dich auf null. Beide Umlagen zusammen betrugen im Jahr 2023 0,948 Cent pro Kilowattstunde. Bei einem durchschnittlichen Stromverbrauch einer Wärmepumpe von 6.000 Kilowattstunden liegt der Erstattungsbetrag bei fast 57 Euro.
Die Verringerung der Umlagen muss beim Netzbetreiber beantragt werden. Da Du aber in der Regel keinen Vertrag mit dem Netzbetreiber hast, musst Du das über den Stromanbieter Deines Wärmepumpenstromtarifs melden. Dafür hast Du jeweils bis zum 28. Februar des Jahres Zeit. Wenn Du die Frist verpasst, kannst Du die Meldung immer noch bis zum 31. März einreichen, dann verringert sich die Reduzierung aber auf 80 Prozent.
Einige Stromversorger bieten Online-Formulare an, die Du nutzen kannst. Ist das nicht der Fall, kannst Du alternativ einen Brief oder ein Fax schicken.
Du kannst unser Musterschreiben für die Meldung zur Verringerung der KWKG- und Offshore-Netzumlage verwenden. Wir bieten eine Vorlage für Dein Schreiben zum Download an. Du musst nur Deine persönlichen Daten ergänzen, es ausdrucken und unterschreiben.
Achtung: Bevor Du die Erstattung der Umlagen bekommst, muss die Verringerung der Umlagen von der EU noch beihilferechtlich freigegeben werden. Trotzdem solltest Du die Meldung schon jetzt vornehmen, um die Fristen nicht zu verpassen. Wann die EU grünes Licht gibt, ist noch offen.
Auch wenn die Wärmepumpe eher eine teure Technologie ist, bekommst Du sehr viel Förderung dafür. Die hohen Anschaffungskosten im Vergleich zu herkömmlichen Heizungen wie Gas- oder Ölheizungen werden dadurch deutlich gemindert. Für eine neue Gasheizung oder Gashybridheizung bekommst Du dagegen seit dem 28. Juli 2022 gar keine Förderung mehr.
Seit dem 1. Januar 2024 dürfen nur noch Heizungen mit einem Anteil von mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien eingebaut werden. Heizungen, die ausschließlich mit Öl oder Gas heizen, sind aber übergangsweise und unter bestimmten Voraussetzungen noch erlaubt. Um die Bürger beim Wechsel auf klimafreundliche Heizungen zu unterstützen, ist bei der staatlichen Förderbank KfW das neue Förderprogramm 458 aufgesetzt worden. Dieses neue Programm besteht aus einer Grundförderung und mehreren Klimaboni, die mit der Grundförderung kombiniert werden können. Bis zu 70 Prozent an Zuschüssen für Deine neue Wärmepumpe sind so möglich.
Wie und wo Du die neue Heizungsförderung beantragst und wie viel Zuschuss Du in welchem Fall bekommen kannst, liest Du in unserem Ratgeber zur Förderung von Wärmepumpen.
Wenn Du so viel Geld nicht auf einmal zur Verfügung hast, kannst Du im Rahmen der neuen Förderung auch einen zinsgünstigen Kredit aufnehmen. Du erhältst mit dem sogenannten Ergänzungskredit bis zu 120.000 Euro pro Wohneinheit für den Heizungstausch und andere Sanierungsmaßnahmen an Deinem Haus. Wenn Du im Eigenheim wohnst und Dein zu versteuerndes Haushaltseinkommen geringer als 90.000 Euro ist, bekommst Du außerdem eine Zinsvergünstigung von bis zu 2,5 Prozentpunkten.
Wichtig ist dabei, dass Du Dich für den Kredit nur qualifizierst, wenn Du auch die staatlichen Fördermittel zum Heizungstausch oder für energetische Sanierungsmaßnahmen nutzt.
Der Kredit läuft über das KfW-Program 358.
Wenn Du Dein Haus energetisch auf Vordermann bringen musst, damit eine Wärmepumpe bei Dir effizient läuft, kannst Du auch für diese Maßnahmen Förderungen erhalten. Für einzelne Maßnahmen kannst Du beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle einen Zuschuss von bis zu 20 Prozent erhalten. Wenn Du Dein ganzes Haus umfassend sanieren möchtest, kannst Du hierfür einen Kredit bei der KfW aufnehmen, der mit Tilgungszuschüssen unterstützt wird.
Prüfe auch, ob Dein Bundesland oder Deine Stadt Dein Vorhaben zusätzlich fördert. Oft kann diese kommunale mit staatlichen Fördermitteln kombiniert werden und Dein Zuschuss so deutlich höher ausfallen. Welche Förderungen in Deinem Bundesland möglich sind, liest Du in unserem Ratgeber zur Förderung von Wärmepumpen.
Statt eine Förderung zu nutzen, kannst Du die Kosten für die Wärmepumpe auch steuerlich absetzen. Für energetische Maßnahmen an Deinem Haus kannst Du über drei Jahre 20 Prozent der Kosten von Deiner Steuerschuld abziehen, maximal kannst Du hier Kosten von 200.000 Euro pro Objekt geltend machen, also 40.000 Euro absetzen.
Bei einer Wärmepumpenheizung, für die Du beispielsweise insgesamt 20.000 Euro ausgegeben hast, könntest Du entsprechend 4.000 Euro absetzen. Bei einzelnen energetischen Maßnahmen wie der Erneuerung der Heizung lohnt sich in der Regel die Kombination aus Förderung der Bafa und Deines Bundeslandes mehr als die steuerliche Absetzung. Bei größeren Maßnahmen solltest Du dagegen immer prüfen, ob sich mehr lohnt, die Kosten von der Steuer abzusetzen. Kombinierbar mit der Förderung ist die steuerliche Absetzung nicht. Du kannst entweder eine Förderung beantragen oder die Gesamtkosten von der Steuer absetzen.
Noch mehr sparen mit Finanztip Deals!
200 € Neukundenbonus für die Eröffnung eines Wertpapierdepots, kostenlose Zeitschriften im Jahresabo und Bahntickets zum Super-Sparpreis. Solche und andere heiße Deals findest Du in unserem Schnäppchen-Portal.
Wenn Du planst, eine Wärmepumpe in Deinem Haus einzubauen, solltest Du erst einmal abschätzen, wie effizient eine Wärmepumpe bei Dir arbeiten könnte. Dafür kannst Du zum Beispiel den Wärmepumpencheck von co2online nutzen. Nach Angabe der notwendigen Informationen zu Deinem Haus kannst Du abschließend sehen, ob eine Wärmepumpenheizung bei Dir funktionieren würde.
Für die Erneuerung der Heizung ist ein Energieeffizienz-Experte im Gegensatz zu anderen energetischen Sanierungsmaßnahmen nicht vorgeschrieben, es ist aber trotzdem ratsam, immer einen Experten in Deine Vorhaben einzubinden. Seine Leistungen für Planung und Baubegleitung kannst Du Dir über das Bafa mit 50 Prozent Zuschuss zu den Kosten fördern lassen. Der Energieeffizienz-Experte wird sich alle Gegebenheiten in Deinem Haus anschauen und kann Dir dann raten, ob und welche Wärmepumpe für Dich geeignet ist. Er kann Dir auch sagen, ob Du im Rahmen des Einbaus vielleicht noch weitere Maßnahmen durchführen solltest, also zum Beispiel einzelne Heizkörper austauschen. Einen Energieeffizienz-Experten in Deiner Region findest Du in der Datenbank der Deutschen Energie-Agentur (dena).
Dann brauchst Du ein Fachunternehmen, das die Wärmepumpenheizung zusammen mit dem Energie-Effizienz-Experten genau auf Dein Haus zugeschnitten plant und dann bei Dir fachgerecht einbaut. Ein geeignetes Unternehmen kannst Du bei der Fachpartnersuche des Bundesverbands Wärmepumpe e.V. finden. Der Heizungsbauer wird Dir ein Angebot für die passende Wärmepumpe für Dein Zuhause unterbreiten.
Wenn Du eine Förderung in Anspruch nehmen möchtest, solltest Du diese jetzt beantragen. Der Antrag muss vor der Auftragserteilung erfolgen. Sobald Du das erledigt hast, kannst Du dem Fachunternehmen den Auftrag erteilen. Es kann sein, dass Du auf den Einbau etwas warten musst, das solltest Du einplanen. Denn Wärmepumpen sind jetzt schon stark nachgefragt, und es wird damit gerechnet, dass die Nachfrage noch mehr steigen wird. Da momentan aber auch die Produktion für Wärmepumpen in Deutschland stark ausgebaut wird, gehen Experten davon aus, dass sie bald besser verfügbar und auch günstiger sein werden.
Wenn das Fachunternehmen Deine Wärmepumpe eingebaut hat, wird es das gesamte Heizsystem noch einmal überprüfen, also zum Beispiel die Wärmepumpe nach Installation richtig einstellen, die Vorlauftemperatur anpassen, die Heizungen spülen und einen hydraulischen Abgleich durchführen.
Damit Du im Fall von Feuer, Leitungswasserschäden oder Einbruchdiebstahl abgesichert bist, solltest Du Deine neue Wärmepumpe auch Deiner Gebäudeversicherung melden. Steht die Wärmepumpe außerhalb Deines Hauses, kann es sein, dass sie nicht von Deiner bestehenden Versicherung abgedeckt wird. Ob Du deswegen Deine Versicherung wechseln oder gleich eine spezielle Wärmepumpenversicherung abschließen solltest, liest Du in unserem Ratgeber Wärmepumpe versichern.
Etwa ein Jahr nach dem Einbau solltest Du Dein Fachunternehmen bitten, das neue System erneut zu überprüfen. Viele Unternehmen bieten das ohnehin an. So können die Installateure sehen, ob die Wärmepumpenheizung so funktioniert, wie es im Vorhinein geplant war. Wenn die Jahresarbeitszahl aber zum Beispiel zu gering ist, oder die Räume nicht richtig warm werden, kann noch einmal nachgearbeitet werden. Wichtig ist, dass Du nicht selbst Dinge an Deiner Heizungsanlage verstellst, wie etwa die Vorlauftemperatur erhöhst, denn dann kannst Du das ganze System durcheinanderbringen, wodurch es viel ineffektiver läuft. Wenn Du Probleme feststellst, wende Dich lieber immer an Dein Fachunternehmen, das die Wärmepumpe eingebaut hat.
Eine Wärmepumpe nutzt Luft, Erde oder Wasser als Wärmequelle. Die aus der Umwelt gewonnene Wärme wird mithilfe von Strom auf die notwendige Temperatur Deiner Heizkörper gebracht. Mehr Details zur Funktionsweise findest Du hier >>
Es gibt unterschiedliche Wärmepumpentypen, die jeweils eine andere Wärmequelle nutzen. Erd- und Grundwasserwärmepumpen gelten dabei als effizienter als Luftwärmepumpen, da die Temperatur im Grundwasser und im Erdreich konstanter ist als die der Außenluft. Welcher Wärmepumpentyp für Dich geeignet ist, liest Du hier >>
Wärmepumpen werden stark gefördert. Bis zu 40 Prozent kannst Du in Form von Zuschüssen vom Bund erstattet bekommen. Auch einzelne Länder, Städte und Kommunen fördern Wärmepumpen zusätzlich. Alles Infos zu Fördermöglichkeiten liest Du hier >>
Spezielle Stromtarife für Wärmepumpen können sich lohnen, denn sie sind oft günstiger als normale Stromtarife. Deine Wärmepumpe braucht dafür aber einen eigenen Zähler und sie muss steuerbar sein. Wie Du den richtigen Wärmepumpenstromtarif findest, erklären wir Dir hier. >>
* Was der Stern bedeutet:
Finanztip ist kein gewöhnliches Unternehmen, sondern gehört zu 100 Prozent zur gemeinnützigen Finanztip Stiftung. Die hat den Auftrag, die Finanzbildung in Deutschland zu fördern. Alle Gewinne, die Finanztip ausschüttet, gehen an die Stiftung und werden dort für gemeinnützige Projekte verwendet – wie etwa unsere Bildungsinitiative Finanztip Schule.
Wir wollen mit unseren Empfehlungen möglichst vielen Menschen helfen, eigenständig die für sie richtigen Finanzentscheidungen zu treffen. Daher sind unsere Inhalte kostenlos im Netz verfügbar. Wir finanzieren unsere aufwändige Arbeit mit sogenannten Affiliate Links. Diese Links kennzeichnen wir mit einem Sternchen (*).
Bei Finanztip handhaben wir Affiliate Links jedoch anders als andere Websites. Wir verlinken ausschließlich auf Produkte, die vorher von unserer unabhängigen Experten-Redaktion ausführlich analysiert und empfohlen wurden. Nur dann kann der entsprechende Anbieter einen Link zu diesem Angebot setzen lassen. Geld bekommen wir, wenn Du auf einen solchen Link klickst oder beim Anbieter einen Vertrag abschließt.
Für uns als gemeinwohlorientiertes Unternehmen hat es natürlich keinen Einfluss auf die Empfehlungen, ob und in welcher Höhe uns ein Anbieter vergütet. Was Dir unsere Experten empfehlen, hängt allein davon ab, ob ein Angebot gut für Dich als Verbraucher ist.
Mehr Informationen über unsere Arbeitsweise findest Du auf unserer Über-uns-Seite.
Klickst Du auf eine Empfehlung mit *, unterstützt das unsere Arbeit. Finanztip bekommt dann eine Vergütung. Empfehlungen sind aufwändig recherchiert und basieren auf den strengen Kriterien der Finanztip-Expertenredaktion. Mehr Infos
